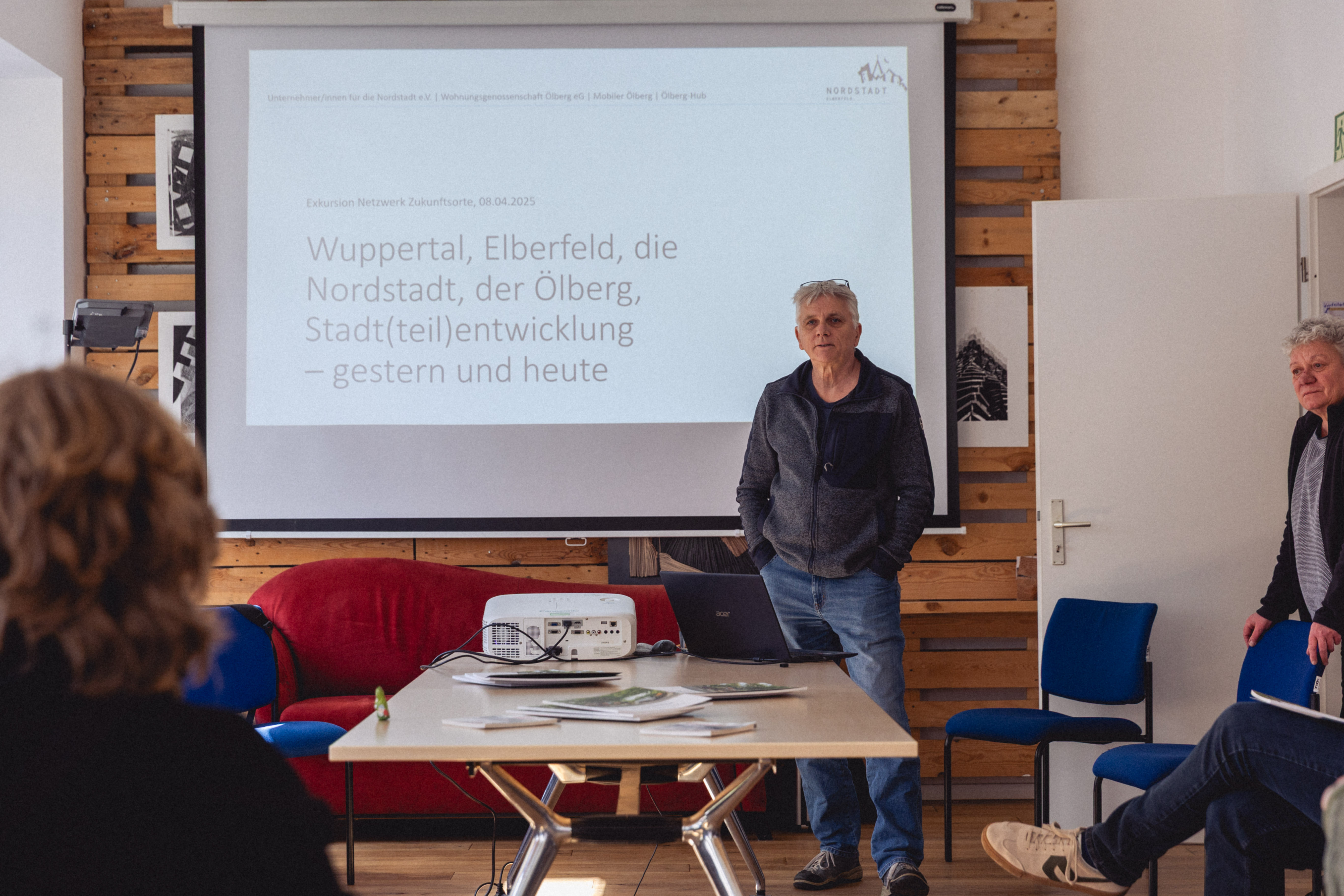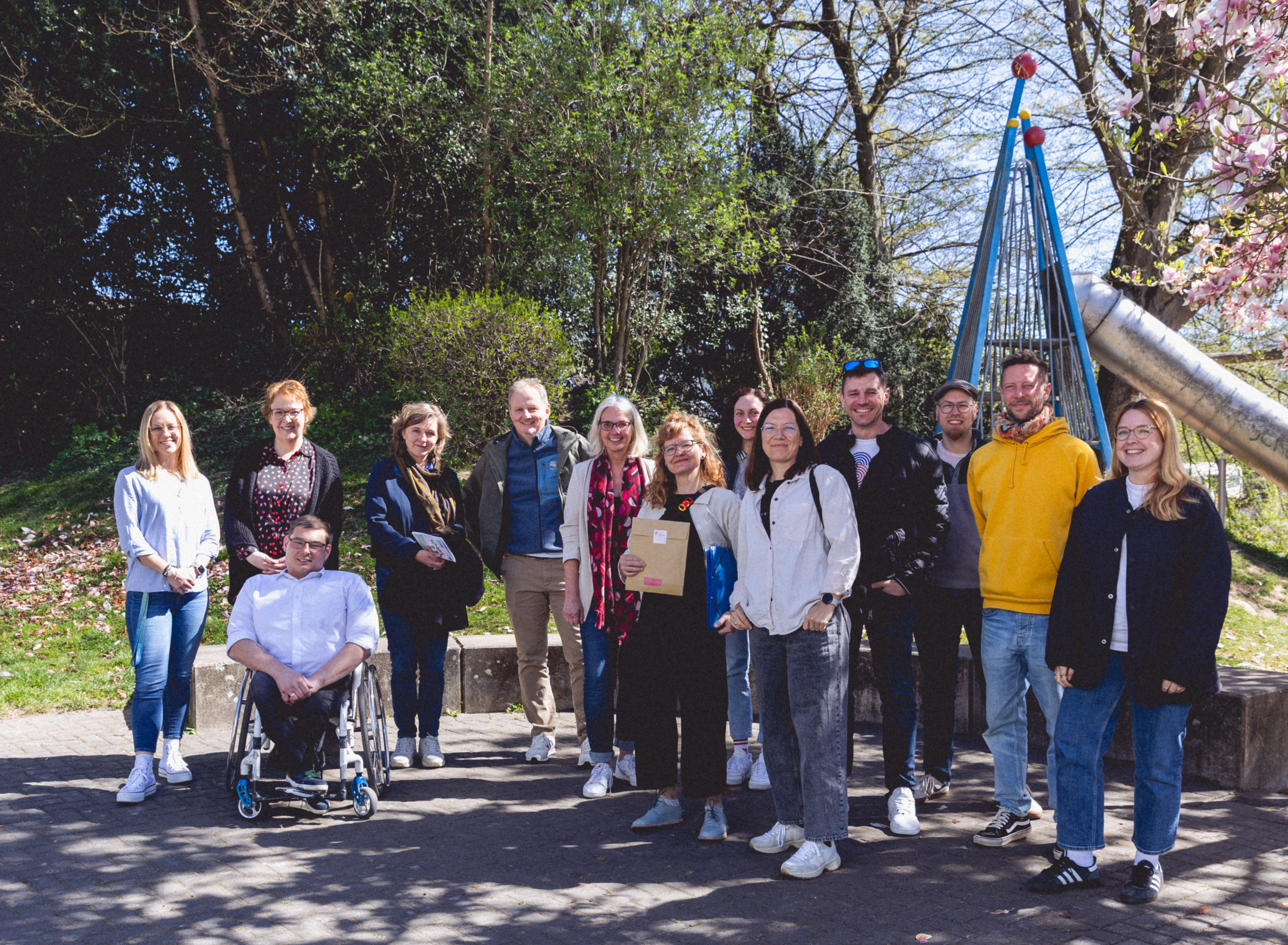Inspirationsreise#3 - Rückblick
Elf Orte, drei Tage, ein Bus voller Fragen – und Antworten, mit denen wir nicht gerechnet hatten.
Was passiert, wenn sich elf Menschen mit einer Passion für Leerstände, gemeinschaftliche Visionen und Gemeinwohlorientierung in einen Kleinbus setzen und quer durch NRW reisen? Man kommt zurück mit Notizbüchern voller Skizzen, Gedanken, Gespräche – und dem starken Gefühl, dass es sich lohnt, genau hinzuschauen. Und zuzuhören. Denn was wir auf dieser Reise gesehen und gehört haben, war nicht nur inspirierend. Es war auch lehrreich, unbequem, motivierend, manchmal irritierend – und oft sehr konkret.

Elf Menschen haben an elf Stationen Halt gemacht: das Zanders-Gelände in Bergisch Gladbach und Sitz der Regionale 25, die Villa Friedlinde in Lohmar, die Brauerei Schwelm, in Wuppertal Gut Einern, Utopiastadt, den Ölberg Hub und die Wiesenwerke, in Windeck Die Station und kabelmetal sowie den Kulturhafen in Au an der Sieg. Unterschiedlicher hätten die Orte nicht sein können – und doch verband sie alle etwas: Der Wille, Räume neu zu denken. Nicht für Rendite, sondern für Gemeinschaft, Begegnung, Kultur, Daseinsvorsorge. In diesem kurzen Recap wollen wir versuchen, die wichtigsten Gedanken, Fragen und Aha-Momente festzuhalten. Nicht als Blaupause, sondern als Einladung zur Weiterentwicklung und Lernens.
Projektentwicklung in Schritten
Was sich an allen Stationen beobachten ließ: Gemeinwohlorientierte Projektentwicklung folgt – bei aller Unterschiedlichkeit – einem wiederkehrenden Ablauf. Ob bewusst geplant oder intuitiv gegangen, es tauchte fast überall dieselbe Reihenfolge auf:
Der Ausgangspunkt ist oft eine intrinsisch motivierte Gruppe – und eine leerstehende Immobilie oder ein Gelände, das ins Blickfeld der Gruppe rückt.
Dann folgt das inhaltliche Profil: Was soll hier entstehen? Für wen? Mit wem? Diese Fragen zu beantworten ist ein Prozess, der von allen Seiten Zeit, Geduld, Mut und Vertrauen braucht - denn hier entsteht die Projekt-DNA.
Die Trägerschaft wird geklärt: Rechtsform, Rollen, Verantwortung. Oft entscheidet sich hier, ob eine Idee tragfähig wird.
Ein Betriebskonzept entsteht: Wie kann das Projekt wirtschaftlich bestehen – ohne die Gemeinwohlorientierung aufzugeben? Kann das Projekt nach Ablauf der Förderung auf eigenen finanziellen Beinen stehen? Was braucht es dafür?
Erst danach wird planerisch gedacht: “Form Follows Function” und Architektur folgt dem Konzept, nicht umgekehrt.
Schließlich kommt die Finanzierung: Manchmal öffnet sich ein Förderfenster, manchmal hilft ein privater Unterstützer, manchmal trägt das Konzept sich selbst. Oder wie jemand sagte: „Gute Ideen finden ihr Geld.“
Diese Reihenfolge war fast überall sichtbar – selbst dort, wo sie nicht bewusst so formuliert wurde. Es wurde deutlich: Wer zu früh in Architektur oder Finanzierung einsteigt, ohne eine solide Basis aus Idee, Struktur und Menschen zu haben, baut auf Sand.
Augenhöhe ist kein Nice-to-have
Immer wenn wir uns an Starken Orten mit Akteur*innen trafen, fiel ein Satz besonders häufig: „Wir wollen keine Bittsteller sein – sondern Partner.“ Und genau das scheint zentral: Gemeinwohlorientierte Initiativen haben einen klaren Anspruch auf Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit Kommunen und Verwaltungen. Das bedeutet Arbeit und ein Selbstverständnis, das sich nicht kleinmacht.
Gleichzeitig braucht es auf Seiten der Verwaltung eine Haltung, die Bürger*innen und Akteure als Mitgestaltende begreift – nicht als Störfaktor im Verfahren. Wenn das gelingt, kann echte Zusammenarbeit entstehen. Wenn das fehlt, wird selbst die beste Idee irgendwann lebensmüde.
Manche Kommunen – vor allem kleinere – profitieren dabei von direkter Unterstützung durch Bürgermeister*innen, die sich persönlich einbringen. In größeren Städten übernehmen diese Rolle häufig Planungs- oder Kulturdezernate. Wichtig ist aber in beiden Fällen: Es braucht eine zentrale Ansprechperson, vielleicht sogar eine “Verwaltungslotsin”, die idealerweise nicht nur vermittelt, sondern mitdenkt.
Kommunikationsformate wie Lenkungskreise und Runde Tische haben sich an mehreren Orten bewährt. Regelmäßige Treffen mit klarer Agenda, bei denen alle Beteiligten – Verwaltung, Initiativen, Eigentümer*innen, Politik – am Tisch sitzen, schaffen Struktur und ermöglichen synchrones Arbeiten. Und sie ermöglichen es, Konflikte früh zu erkennen, bevor sie zu Blockaden werden. Das Dumme nur: Niemand meint dafür Zeit zu haben! Wir haben gelernt: Nehmt Euch die Zeit! Am Ende kommt ihr so schneller und mit weit weniger Reibungsverlusten ans Ziel.

BOB Campus Wuppertal

Zanders-Gelände Bergisch Gladbach

Utopia Stadt

Brauerei Schwelm

Landfabrik Windeck

Wiesenwerke Wuppertal

Foto ©Lukas Ullrich, kleinlaut.biz

Foto ©Lukas Ullrich, kleinlaut.biz

Foto ©Lukas Ullrich, kleinlaut.biz

Brauerei Schwelm

Foto ©Lukas Ullrich, kleinlaut.biz

Foto ©Lukas Ullrich, kleinlaut.biz






Übersetzungsarbeit ist Teil der Aufgabe
Eine der größten Herausforderungen zeigte sich immer wieder an der Schnittstelle zwischen engagierten Gruppen und Verwaltung: die unterschiedliche Logik. Während viele Initiativen ganzheitlich denken wollen – Nutzung, Nachbarschaft, Ökologie, Bildung, Kultur zusammen –, sind Verwaltungen oft sektoral organisiert. Es gibt das Bauamt, das Liegenschaftsamt, das Kulturreferat, die Wirtschaftsförderung – aber selten einen Ort, an dem die Fäden zusammenlaufen.
Das bedeutet: Gemeinwohlorientierte Projekte müssen oft Übersetzungsarbeit leisten. Sie müssen verwaltungskompatibel argumentieren, ohne ihre eigene Sprache zu verlieren. Und sie brauchen das Verständnis dafür, dass Fördermittel, Zuständigkeiten und Planungsrecht eigene Regeln haben – auch wenn diese nicht immer sinnvoll erscheinen. An mehreren Orten wurde genau das erfolgreich gelöst – durch beharrliches Dranbleiben, durch persönliche Beziehungen, durch Geduld. Und manchmal auch durch pragmatische Zwischenschritte, wie temporäre Nutzungen oder schrittweise Entwicklung. Das senkt Investitionshürden – und schafft Vertrauen durch offensichtliche Machbarkeit.
Konflikte gehören dazu
Ein weiteres Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Reise zog: Reibung ist unvermeidlich. Ob innerhalb von Gruppen, zwischen Eigentümer*innen und Nutzer*innen, zwischen gemeinnützigen und gewerblichen Akteur*innen – es knirscht fast überall irgendwann. Aber das ist kein Zeichen des Scheiterns. Verhandlung ist Teil des Prozesses.
Entscheidend ist, wie mit diesen Konflikten umgegangen wird. Einige Orte haben Moderationsformate etabliert, andere holen externe Prozessbegleiter*innen dazu. Wieder andere arbeiten mit klaren Vereinbarungen, Rollenprofilen, partizipativen Entscheidungsstrukturen. Gemeinsam ist ihnen: Sie nehmen Konflikte ernst – und nicht persönlich.
Vertrauen als Infrastruktur
Vielleicht war das wichtigste gemeinsame Element aller besuchten Projekte: Vertrauen. Nicht als romantisches Ideal, sondern als Arbeitsgrundlage. Vertrauen zwischen Menschen. Zwischen Initiativen und Verwaltung. Zwischen Eigentümerinnen und Nutzerinnen. Ohne diesen Vorschuss geht es nicht. Denn viele der Projekte bewegen sich in rechtlichen Grauzonen, in finanzieller Unsicherheit, in planerischen Zwischenräumen. Wer dort arbeiten will, braucht Mut. Und Menschen, die sich gegenseitig ernst nehmen – auch ohne fertigen Masterplan.
Ein Satz aus Utopiastadt bringt es auf den Punkt:
„Eine gemeinwohlorientierte Leerstandsentwicklung kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten bereit sind, sich auf einen agilen Prozess mit offenem Ausgang einzulassen – und das nicht trotz, sondern wegen des Vertrauensvorschusses.“
Ohne Fördertöpfe geht es nicht
Ein nicht zu verschweigender Aspekt ist die finanzielle Unterstützungsnotwendigkeit in der Konzept- und Umsetzungsphase aller Projekte, egal ob kommunal, zivilgesellschaftlich oder kooperativ. Trotz hoher intrinsischer Motivation und großem ehrenamtlichen Engagement der Projektbeteiligten über viele Jahre sind kommunale Fördertöpfe, Landesprogramme wie Dritte Orte, Initiative ergreifen und das Strukturprogramm Regionale 25, aber auch Bundesprogramme wie die der Städtebauförderung oft unerlässlich für das Umsetzen solcher kooperativen bottom-up-linked Prozesse von nachhaltiger, gemeinwohlorientierter Altbauaktivierung - selbst wenn gemeinwohlorientierte Impact-Entwickler wie die Montag Stiftung Urbane Räume Initial geben. Bleibt zu fordern, dass mit den baukulturellen Leitlinien des Bundes das Versprechen umgesetzt wird, vermehrt solche unbürokratischen und wirkungsvollen Fördermöglichkeiten flächendeckend ausgerollt werden und durch Initiativen wie HouseEurope! neue EU-Gesetze, die Renovierungen und Umbauten einfacher, günstiger und sozialer machen, vorangebracht werden.
Und jetzt?
Unsere Reise war kurz. Aber sie hat viel ausgelöst und uns gezeigt: Es gibt keine Standardlösung. Kein Copy-Paste-Rezept. Jeder Ort, jedes Projekt, jede Gruppe ist anders. Und doch gibt es Muster, wiederkehrende Herausforderungen, typische Hürden – und bewährte Wege, sie zu nehmen.
Auf unseren Social Media Kanälen (LinkedIn, Instagram) beginnt ab kommender Woche ein Reise-Recap, das Euch alle nochmal an die Orte mitnimmt, die wir während unserer Reise besucht haben.
Bis dahin bleibt uns nur zu sagen:
Bleibt neugierig. Und mutig. Und vor allem: gemeinsam unterwegs.
Euer Starke Orte-Team

Gut Einern Wuppertal

Graswurzelhof Au (Sieg)

Ölberg-Hub Wuppertal

Villa Friedlinde Lohmar

Kabelmetal Windeck

Bahnhof Au (Sieg)

Foto ©Lukas Ullrich, kleinlaut.biz

Foto ©Lukas Ullrich, kleinlaut.biz

Ölberg-Hub Wuppertal

Foto ©Lukas Ullrich, kleinlaut.biz

Foto ©Lukas Ullrich, kleinlaut.biz

Foto ©Lukas Ullrich, kleinlaut.biz